Artikelarchiv
Innovation__Alles smart, oder was?

Smarte Produkte sind in, aber so ganz genau wissen wir oftmals gar nicht, was smart bedeutet. Trotzdem will jeder smart sein und benötigt dazu natürlich die passenden Produkte und Prozesse.
Würde man 100 Leute auf der Straße danach fragen, was smart bedeutet, würde man vermutlich fast genauso viele unterschiedliche Antworten bekommen. Auf der Suche nach einer Definition findet man Ansätze aus Gesellschaftstheorie, Wirtschaft, Technik und anderen Themenfeldern. Gemein ist allen Beschreibungen stets, dass smart etwas Überlegenes und Fortschrittliches ist – und meistens irgendwie digital.
In der Technik etwa beschreibt smart solche Systeme oder Geräte, die durch integrierte Sensoren, Algorithmen und oft auch Technologien der Künstlichen Intelligenz in der Lage sind, Daten zu sammeln, zu analysieren und darauf basierend eigenständig und optimiert Entscheidungen zu treffen. Dies schließt oft die Vernetzung dieser Geräte über das Internet ein.
Im Produktdesign bedeutet smart hingegen, dass ein Produkt nicht nur funktional, sondern auch intuitiv bedienbar, ästhetisch ansprechend und auf die Bedürfnisse des Nutzers zugeschnitten ist. Smarte Produkte vereinen Funktionalität mit fortschrittlicher Technologie, oft in minimalistischer Form.
Und in der Wirtschaft beschreibt smart datengetriebene und automatisierte Lösungen, die beispielsweise Prozesse effizienter gestalten oder den Kundenservice verbessern. Mit solchen Ansätzen versuchen Unternehmen, sich Wettbewerbsvorteile durch Innovation und Optimierung zu verschaffen.
Ein Wachstumstreiber
Was auch immer man im Einzelnen genau unter diesem Begriff verstehen möchte – feststeht, dass der Markt für smarte Produkte seit Jahren ein Wachstumstreiber ist, und zwar über praktisch alle Branchen hinweg. Für Deutschland beispielsweise prognostiziert das Statistik-Portal Statista, dass der Umsatz im Bereich smarter Haushaltsgeräte im Jahr 2028 etwa vier Milliarden Euro erreichen wird.
Anderes Beispiel, gleiche Aussage: Der Markt für Smart-Watches, also Uhren mit Computer, Sensoren und weiterem Schnickschnack, wird laut Statista in den kommenden Jahren in Europa jeweils um rund zehn Prozent wachsen. Das weist auf eine zunehmende Akzeptanz solcher Technologien im Alltag hin und gibt auch der Heimtierbranche einen deutlichen Fingerzeig, wohin die Reise geht.
Gewohnheiten ändern sich
Kunden werden sich immer mehr an die Funktionen intelligenter und vernetzter Produkte gewöhnen. Diese Gewohnheit werden sie nicht ablegen, wenn sie ein Zoofachgeschäft betreten. Wer dann nicht die passenden Güter oder Dienstleistungen anbieten kann, wird es vermutlich immer schwerer haben.
Für die Wertschöpfungskette der Heimtierbranche ist diese Entwicklung auf zweierlei Weise bedeutsam: Zum einen müssen eben die passenden Produkte entwickelt und angeboten werden, zum anderen muss aber auch der eigene Geschäftsbetrieb möglichst smart aufgestellt sein, um im Konkurrenzkampf weiter eine Rolle spielen zu können. Jedes Unternehmen wird sich auf ein gewisses Maß an Transformation in diese Richtung einstellen müssen.
Gerade die großen Firmen gehen hier mit monetärem Potenzial voran, aber auch für kleinere und mittlere scheint es unerlässlich, sich mit dem Thema tiefgehend auseinanderzusetzen und zu schauen, was machbar ist. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt.
Vielfältige Möglichkeiten
Im Handel können smarte Beleuchtungssysteme Produkte gezielt inszenieren und obendrein Strom sparen. Digitale Regalplatzierungssysteme überwachen mit Kameras und anderen Sensoren die Bestandsmengen und lösen automatisch Nachbestellungen aus. Andere Sensoren überwachen die Bewegungen der Kunden und helfen bei der Analyse, um Warenpräsentationen zu optimieren.
Über elektronische Preisschilder lassen sich Auszeichnungen in Echtzeit anpassen und können mit Rabatt-Aktionen verknüpft werden. Augmented-Reality-Systeme zeigen den Kunden, wie ein Produkt im Zuhause des Heimtieres aussehen könnte. Virtuelle Beratungsstationen geben Informationen und unterstützen die Kaufentscheidung. App-basierte Systeme sprechen die Kunden mittels Push-Nachrichten an und unterbreiten personalisierte Angebote. Automatisierte Click-and-Collect-Lösungen stellen die bestellten Waren zur Abholung bereit.
Daten sammeln für den Erfolg
All diesen Beispielen wohnt der wesentliche Nutzen inne, dass ein Unternehmen Daten sammeln kann, um sie für die weitere Optimierung der Geschäfte zu nutzen und sich immer weiter den Kundenbedürfnissen anzunähern. Das ist übrigens auch eines der Geheimnisse des Erfolges der großen Online-Marktplätze.
Auch die Produktwelt wird immer smarter. Per App lassen sich Futterspender automatisch steuern, Sensoren überwachen die Wasserqualität in Trinkbrunnen und benachrichtigen den Halter, wenn eine Reinigung ansteht. Auch Katzentoiletten analysieren heute den Zustand der Streu selbst und geben Bescheid, wenn die Katze ein gesundheitliches Problem haben könnte. Mit GPS-Trackern können Halter den Standort ihrer Tiere nachvollziehen und so mancher freiheitsliebende Streuner wird schließlich wiedergefunden, wenn er sich allzu weit weg von Zuhause aufhält.
Interaktive Spielzeuge sollen für Kurzweil sorgen und können über Smartphone vom Halter aktiviert werden. Und in der Aquaristik, einem sowieso schon naturwissenschaftlich-technisch geprägten Segment der Heimtierbranche, tun sich mit smarter Technik völlig neue Anwendungsmöglichkeiten hinsichtlich Überwachung und Steuerung komplexer Biotope auf.
Die Entwicklung in all diesen Bereichen steht noch am Anfang und kreative Köpfe bringen fast täglich neue Ideen auf den Tisch. Nicht alles davon wird marktreif oder sogar erfolgreich. Aber wenn von zehn Ideen nur eine zündet, kann das schon den ökonomischen Grundstein für die kommenden Jahre legen. Am Ende wird es wohl so kommen, wie uns die Informatiker schon seit Jahrzehnten glauben machen wollen: Alles, was digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert.
Dominic Heitz

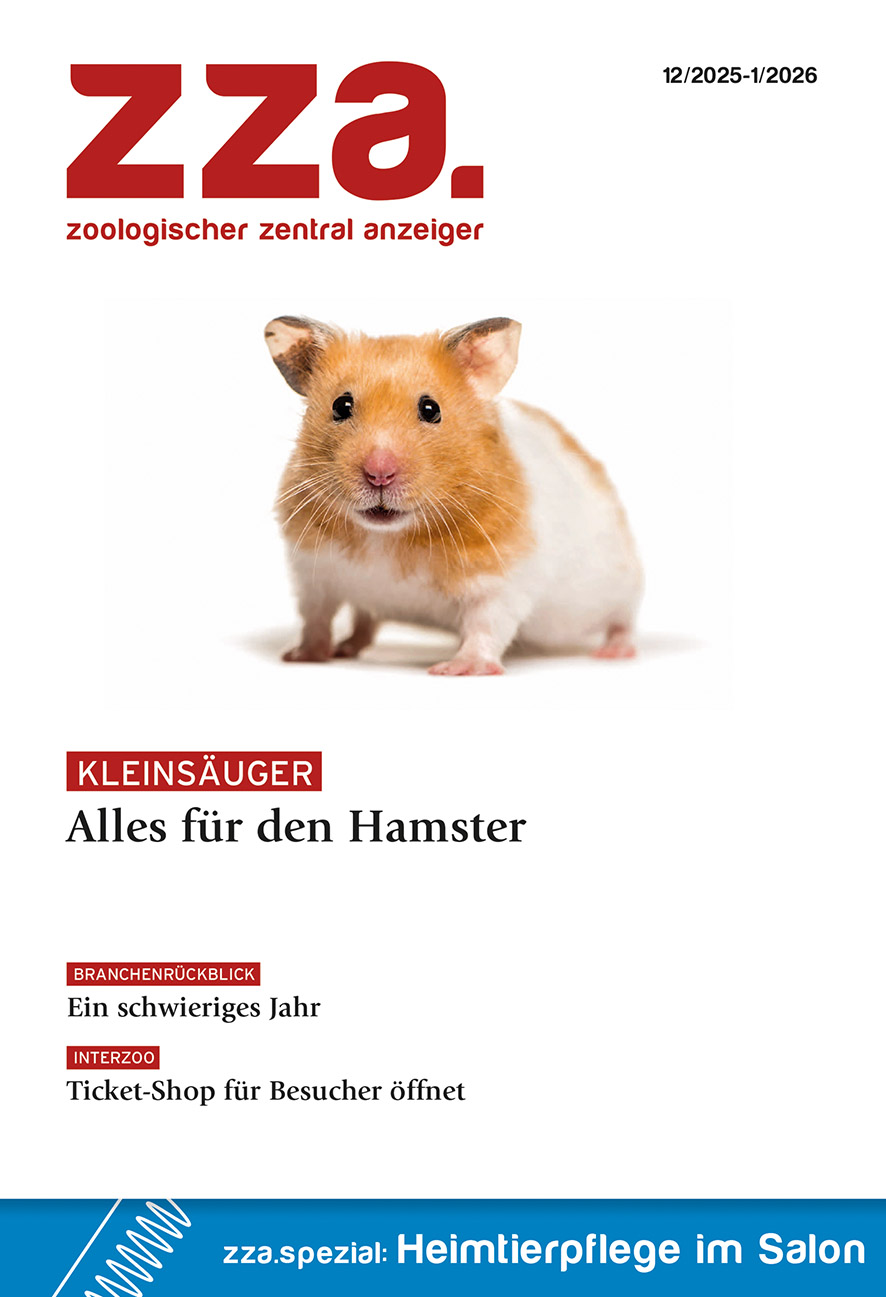
 Seite empfehlen
Seite empfehlen Bookmark
Bookmark Drucken
Drucken
 vorheriger Artikel
vorheriger Artikel